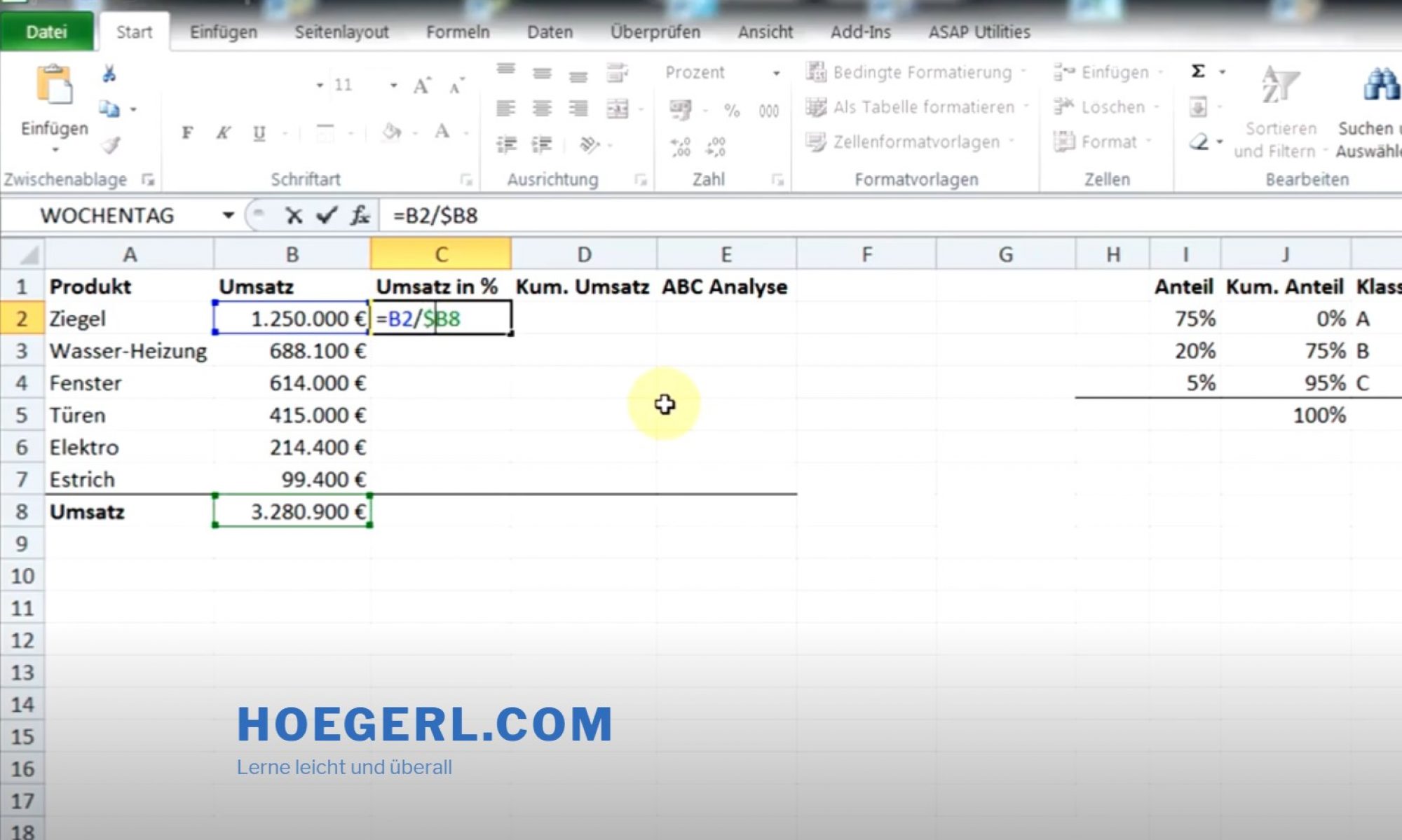Was ist JSON?
JSON (JavaScript Object Notation) ist ein textbasiertes Format zur Darstellung strukturierter Daten, das ursprünglich aus der JavaScript-Welt stammt, aber heute von nahezu jeder Programmiersprache unterstützt wird. Es wird insbesondere im Webumfeld verwendet, z. B. beim Austausch von Daten zwischen Client und Server.
JSON ist einfach lesbar, sowohl für Menschen als auch für Maschinen. Die Syntax basiert auf einer Untermenge der JavaScript-Objektnotation, jedoch ohne deren Funktionsumfang.
Aufbau und Struktur von JSON
JSON besteht aus zwei Hauptstrukturen:
- Objekte – eine ungeordnete Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren.
- Arrays – eine geordnete Liste von Werten.
1. JSON-Objekt
{
"name": "Max Mustermann",
"alter": 35,
"verheiratet": false
}
2. JSON-Array
[
"Apfel",
"Banane",
"Kirsche"
]
Gültige Datentypen in JSON
- Zeichenkette (String) → „Beispiel“
- Zahl (Number) → 123.45
- Objekt → {…}
- Array → […]
- Boolean → true oder false
- Null → null
Verschachtelte Strukturen
{
"benutzer": {
"id": 1001,
"name": "Anna",
"rollen": ["admin", "editor"]
}
}
Rolle der Klammern in JSON
{ } definieren ein Objekt.
[ ] definieren ein Array.
Diese Klammern sorgen für die logische Strukturierung der Daten. JSON-Dateien müssen wohlgeformt sein – jeder öffnenden Klammer muss eine schließende gegenüberstehen, und die Syntax muss exakt eingehalten werden.
JSON im Einsatz – ein typisches Anwendungsbeispiel
{
"id": 12345,
"vorname": "Lisa",
"nachname": "Müller",
"email": "lisa.mueller@example.com",
"newsletter": true
}
JSON in verschiedenen Programmier- und Scriptsprachen
JavaScript
const jsonString = '{"name":"Tom","alter":28}';
const obj = JSON.parse(jsonString);
console.log(obj.name);
const backToJson = JSON.stringify(obj);
Python
import json
json_str = '{"name": "Tom", "alter": 28}'
obj = json.loads(json_str)
print(obj['name'])
new_json = json.dumps(obj)
Java
import org.json.JSONObject;
String jsonString = "{\"name\":\"Tom\",\"alter\":28}";
JSONObject obj = new JSONObject(jsonString);
System.out.println(obj.getString("name"));
JSON im Vergleich zu XML
| Kriterium | JSON | XML |
|---|---|---|
| Lesbarkeit | Einfach | Komplexer |
| Datenmenge | Kompakter | Umfangreicher |
| Parsing | Schnell und nativ | Aufwendiger |
| Unterstützung | Sehr gut | Weit verbreitet |
| Schemadefinition | JSON Schema | XSD |
Sicherheit und JSON
Beim Umgang mit JSON-Daten ist besondere Vorsicht geboten, wenn diese von externen Quellen stammen. Mögliche Angriffsvektoren sind:
- JSON Injection
- Cross-Site Scripting (XSS)
- Parsing-Fehler
Validierung von JSON
Zur Sicherstellung der Datenintegrität kann ein JSON Schema verwendet werden:
{
"type": "object",
"properties": {
"name": { "type": "string" },
"alter": { "type": "integer" }
},
"required": ["name", "alter"]
}
Beispiel mit der Konfiguration einer Anwendung mit JSON
{
"server": {
"port": 8080,
"useSSL": true
},
"database": {
"host": "localhost",
"user": "root",
"password": "geheim"
}
}
JSON und Datenbanken
Moderne Datenbanken wie MongoDB oder PostgreSQL unterstützen JSON-Datentypen:
SELECT info->>'name' FROM benutzerWHERE info->>'rolle'='adm';Vollständiges JSON-Beispiel
{
"projekt": "Sensorüberwachung",
"version": "1.0.3",
"sensoren": [
{
"id": 101,
"typ": "Temperatur",
"einheit": "Celsius",
"wert": 23.4
},
{
"id": 102,
"typ": "Luftfeuchtigkeit",
"einheit": "%",
"wert": 45.2
}
],
"status": "aktiv",
"letzteAktualisierung": "2025-06-17T10:45:00Z"
}
Fazit
JSON hat sich als eines der wichtigsten Datenformate im Bereich der modernen Softwareentwicklung etabliert. Es bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, strukturierte Informationen zu speichern, zu übertragen und zu verarbeiten. Ob bei der Kommunikation zwischen Frontend und Backend, dem Speichern von Konfigurationen oder beim Zugriff auf APIs – JSON ist universell einsetzbar.
Die klare Struktur, die breite Unterstützung durch nahezu alle Programmiersprachen und die hervorragende Lesbarkeit machen JSON sowohl für Entwickler als auch für Maschinen zur ersten Wahl. Es ersetzt in vielen Anwendungsfällen ältere Formate wie XML und überzeugt durch Einfachheit, Flexibilität und Effizienz.
Trotz aller Vorteile sollten Entwickler Sicherheitsaspekte wie Datenvalidierung, fehlerhafte Strukturierung und potenzielle Injection-Angriffe stets im Blick behalten. Mit gezieltem Einsatz von JSON-Schema und bewährten Bibliotheken lassen sich diese Risiken jedoch kontrollieren.
Insgesamt lässt sich sagen: JSON ist schlank, zuverlässig und unverzichtbar.
„JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch“ weiterlesen