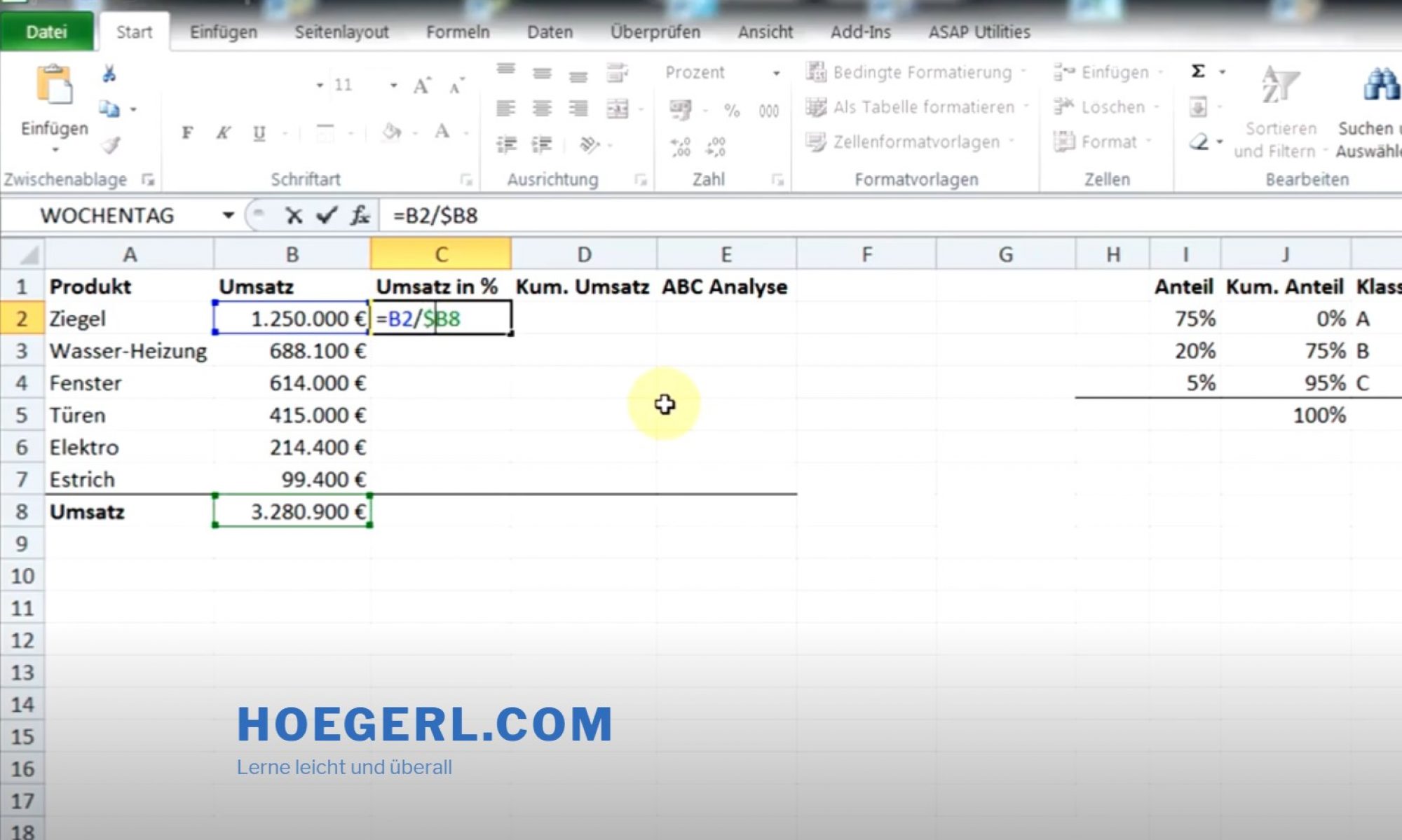Die chinesische Technologiebranche hat einen bemerkenswerten Meilenstein mit der Vorstellung des GR-1, eines humanoiden Roboters von dem Unternehmen Fourier Intelligence erreicht.
Präsentiert auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, beeindruckte dieser Roboter mit seiner Fähigkeit, auf zwei Beinen mit 5 km/h zu laufen und dabei eine Last von 50 kg zu tragen. Die Entstehungsgeschichte von Fourier Intelligence, das ursprünglich 2015 mit einem Fokus auf Rehabilitationsrobotik gegründet wurde, zeugt von einer beeindruckenden Diversifikation in ihrem Angebot.
Roboter als Begleiter und Helfer in China
Fourier Intelligence teilt die Vision von Tesla CEO Elon Musk, der humanoiden Robotern eine Rolle in alltäglichen Aufgaben und als Begleiter zuschreibt. Das Unternehmen plant, die GR-1-Roboter für Forschung und Entwicklung einzusetzen, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres 2023 in die Massenproduktion zu gehen. Die Vision ist, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren humanoide Roboter zum integralen Bestandteil des täglichen Lebens werden können.
Sicherheitseinsatz von Robotern in den USA
In den USA gewinnen Sicherheitsroboter, insbesondere für den Einsatz in Reaktion auf steigende Kriminalitätsraten, zunehmend an Popularität. Der globale Sicherheitsrobotermarkt wird voraussichtlich bis 2030 auf 31,08 Milliarden Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,8 %. Das ist für Börsenspekulanten und Unternehmen wie Black Rock lukrativ.
Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist Knightscope, Inc.. Es ist ein fortschrittliches Unternehmen der Sicherheitstechnologie aus dem Silicon Valley. Gegründet im Jahr 2013, nutzt das Unternehmen Technologien wie Autonomie, Robotik, künstliche Intelligenz und Elektrofahrzeugtechnik, um einzigartige Lösungen zu entwickeln. Ihre Technologie hat bereits über 2,3 Millionen Stunden im realen Feldeinsatz verbracht. Zu den Kunden von Knightscope gehören hochkarätige Organisationen wie das New York Police Department (NYPD) und das New York City Fire Department (FDNY).
Knightscope hat im Laufe des Jahres mehrere bedeutende Verträge abgeschlossen, darunter einen mit der Rutgers University in New Jersey sowie einen Pilotvertrag mit dem NYPD für einen K5-Roboter, der eine U-Bahn-Station in Manhattan patrouilliert.
Sicherheitseinsatz von Robotern in der EU
In der Europäischen Union steht die Robotik ebenfalls im Fokus, insbesondere in Bezug auf Sicherheitsanwendungen. Die EU hat in den letzten Jahren in Forschung und Entwicklung im Bereich der Robotertechnologie investiert, mit dem Ziel, die Effizienz und Sicherheit in verschiedenen Sektoren zu verbessern. Obwohl spezifische Pläne und Entwicklungen variieren können, konzentriert sich die EU in der Regel auf die Integration von Robotertechnologie in Bereichen wie der öffentlichen Sicherheit, der Industrie und der Gesundheitsversorgung.
Fazit
Der Fortschritt im Bereich der Robotik, insbesondere der humanoiden Roboter wie der GR-1 aus China und Sicherheitsroboter in den USA und der EU, zeigt das enorme Potenzial dieser Technologien. Während China sich auf die Entwicklung von humanoiden Robotern konzentriert, fokussieren die USA und die EU auf den Einsatz von Robotern zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Effizienz.
2. https://fourierintelligence.com
3. https://www.knightscope.com